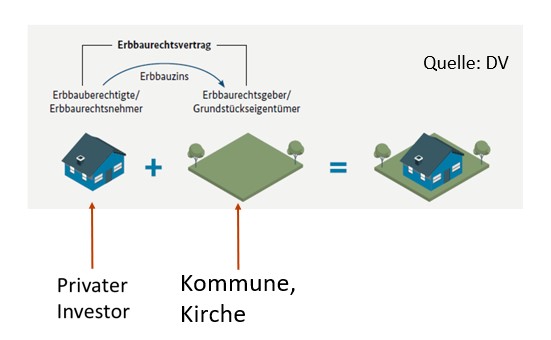Dirk Löhr
In diesem Blog wurde schon wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestrebungen der EU wie auch von Teilen der Bundesregierung zur energetischen Gebäudesanierung zu einem erheblichen Teil redundant und überflüssig sind. Der Emissionshandel, der im Rahmen des EU ETS 2 ab 2027 auch für Gebäude gelten wird, ist als Leitinstrument ausreichend. Auf dieser Basis können die Eigentümer von Gebäuden selbst entscheiden, ob und – wenn ja – welche Art von Sanierung sich lohnt. Administrative Vorgaben, die v.a. in peripheren Regionen leicht zu wirtschaftlichen Totalschäden führen könnten (wenn die Sanierungskosten in keinem Verhältnis zum Gebäuderestwert stehen) könnten so vermieden werden.
Die grundsätzliche Beschränkung auf das Leitinstrument Emissionshandel wäre im Übrigen auch ein Beitrag zu den ökologischen Strategien der Effizienz und Suffizienz. Bestätigt wird dies ein weiteres Mal durch einen Beitrag von Daniel Stelter im Handelsblatt vom 14.04.2024. Stelter bezieht sich dabei auf mehrere Studien (v.a. mit Bezug auf Großbritannien), nach denen sich der modellierte Energieverbrauch gemäß Energieeffizienzklasse erheblich vom tatsächlichen Energieverbrauch unterscheidet (zu den Studien s. den Anhang). Die am wenigsten energieeffizienten Häuser verbrauchen deutlich weniger, energieeffizientesten Häuser deutlich mehr Energie als von den Modellen behauptet.
Stelter: “Im Vereinigten Königreich haben Studien gezeigt, dass der gemessene Gasverbrauch über alle Energieeffizienzklassen hinweg fast immer innerhalb des für Klasse C unterstellten Bereichs liegt. Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen modelliertem und tatsächlichem Verbrauch in der schlechtesten Energieklasse. Der tatsächliche Energieverbrauch der Klasse G liegt ungefähr auf dem Niveau der Klasse C und nur wenig höher als in den Klassen A und B. Erzwingt man hier also eine Sanierung, dürfte sich am Energieverbrauch wenig ändern.”
Mit anderen Worten: Die Bewohner wenig energieeffizienter Wohnungen verhalten sich schon heute suffizient. Sie ziehen sich einen Pullover an oder heizen bestimmte, wenig genutzte Räume nicht mehr.
Ein ernsthaft umgesetzter CO2-Handel auch für das Gebäudesegment würde die entsprechenden Anreize noch verstärken, das Klimageld gleichzeitig für einen sozialen Ausgleich sorgen. Dies umzusetzen wäre die Aufgabe der Politik, nicht kleinteiliges Mikromanagement!
Anhang: Bezugnahme auf Studien über den Energieverbrauch
J. Few et al. (2023): The over-prediction of energy use by EPCs in Great Britain: A comparison of EPC-modelled and metered primary energy use intensity. Energy and Buildings Vol. 288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113024
M. Lees (2023): Why misleading EPC ratings are a national scandal. The Times, 27.02. Online: https://www.thetimes.co.uk/article/why-misleading-epc-ratings-are-a-national-scandal-ztc5ss2b0
M. Kumar (2023): Behind the scenes: Our resonse. Medium, 4. März. Online: https://madhuban-kumar.medium.com/behind-the-scenes-our-response-453c7d7b82ec