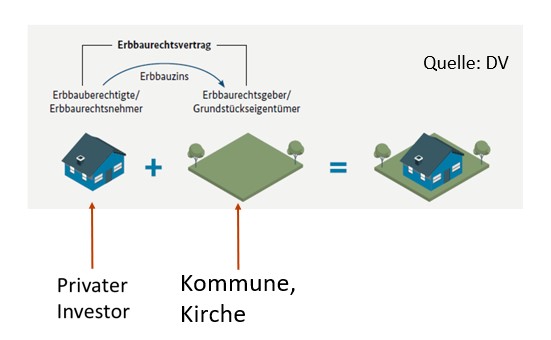Dirk Löhr
Ein zentrales Ziel der gegenwärtigen Energiewende in Deutschland ist die Einsparung von CO2. Unser Land trägt rd. 1,8 % des CO2-Ausstoßes an diesem Planeten bei; zu wenig, um im Rahmen eines Alleingangs “die Welt zu retten”. Die Bundesregierung möchte allerdings eine Blaupause zeichnen, an der sich andere Länder orientieren können. Gegenwärtig dürfte jedoch die Art und Weise, wie die Energiewende vollzogen wird, eher als abschreckendes Beispiel dienen (Wall Street Journal: World’s dumbest energy policy). Schieben wir dies aber einmal beiseite und gehen wir nachfolgend kontrafaktisch von der Annahme aus, dass andere Länder sich unserem Modell der Energiewende anschließen.
Entscheidend für den Erfolg der Energieeinsparung ist der Umgang mit fossilen Energieträgern. Was hierbei an Kohlenstoffen in den Verkehr kommt, landet früher oder später wieder in der Atmosphäre. Die Bundesregierung verfolgt nun einen Ansatz, der mittels der Substitution von fossilen durch erneuerbare Energien auf eine Reduktion der Nachfrage nach fossilen Energien abzielt. Das Problem hierbei ist, wie nachfolgend skizziert wird, dass die Angebotsseite vernachlässigt wird.
Die Angebotsseite von nicht erneuerbaren Ressourcen (hier: von fossilen Energiequellen) kann durch die sog. Hotelling-Regel beschrieben werden. Die Zielfunktion des Eigentümers ist dabei die Maximierung seines Vermögens. Grob vereinfacht dargestellt beschreibt die Hotelling-Regel folgende Zusammenhänge:
Im Laufe der Zeit, mit zunehmender Verknappung durch Ressourcenextraktion steigt der Wert der Ressourcen in situ V an, und zwar in Höhe des Zinssatzes r. Dieser Satz beschreibt auch den Ertrag, der durch Förderung der Ressourcen und Anlage des Erlöses am Kapitalmarkt erzielt werden kann. Erhöht sich der Wert der Ressourcen in situ V stärker als die Rendite aus der Ausbeutung (bzw. der Zinssatz) r, lassen die Eigentümer der Ressourcen im Boden – so kann der Wert des Vermögens V maximiert werden: v > r, mit v = dV/V (große Buchstaben stehen nachfolgend für Bestände, Kleinbuchstaben für Veränderungsraten). Ist umgekehrt der Zins höher als der Wertzuwachs des Ressourcenvermögens in situ (r>v), geht es anders herum. Es kommt zu verstärkter Extraktion (und CO2-Belastung), bis sich knappheitsbedingt der Wert der Ressource V wieder nach oben angepasst hat. Die Rendite aus der Ausbeutung bzw. der Satz r, zu dem sich die Gewinne aus der Ausbeutung verzinsen, bestimmen somit den langfristigen Gleichgewichtspfad. Im Gleichgewicht steigt der Wert der Ressource in situ mit dem Zinssatz an: v = r.
Obwohl das Hotelling-Theorem für die Ressourcenökonomie bahnbrechend war, wurde es aus mehreren Gründen kritisiert. Einer davon war der empirische Befund, dass sich der Preis bestimmter wichtiger Ressourcen (wie Rohöl) nicht mit der Dynamik entwickelte, die nach der Hotelling-Regel zu erwarten gewesen wäre – wenngleich der Preis im Trend gestiegen ist.

Um dieser Kritik zu begegnen, muss man die Hotelling-Regel jedoch nicht verwerfen, sondern lediglich modifizieren. Hintergrund ist, dass die Hotelling-Regel auf herkömmlichen Kapitalwertüberlegungen basiert. Ausbeutungsrechte an Ressourcen lassen sich jedoch viel besser als Realoptionen verstehen: Sie gewähren das Recht, aber nicht die Pflicht, die Ausbeutung innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorzunehmen. Man kann also die Ausbeutung von Teilen der Ressourcen in die Zukunft schieben. Dieses “Warten-Können” stellt eine Flexibilität dar, die einen eigenständigen – und erheblichen – Wert hat. Ausgebeutet werden die Ressourcen nur dann, wenn der Preis der Ressource so hoch ist, dass er die Förderkosten und den bei Ausbeutung verlustig gehenden Wert des “Warten-Könnens” überkompensiert, also bei r>f.
Die o.a. Gleichgewichtsüberlegung von Hotelling kann durch die Veränderung des Wertes des “Warten-Könnens” f ergänzt werden . Das Gleichgewicht ergibt sich dann als:
r + f = v
Die Veränderungsrate des Werts der Ressource bzw. entspricht in dieser einfachen Modifikation also der Rendite bei Ausbeutung und der Veränderung des Wertes des “Warten-Könnens” (wobei der Wert des “Warten-Könnens” nur bei Nicht-Ausbeutung der Ressource realisiert werden kann).
Diese Perspektive kann zusammen mit der Entdeckung weiterer Ressourcenvorkommen und technologiebedingten Effizienzsteigerungen eine Erklärung dafür liefern, warum der Bestand an nicht erneuerbaren Ressourcen höher ist, als nach der Hotelling-Regel zu erwarten wäre. Beispiel Erdöl: So betrug im Jahre 1940 die Reichweite der Erdölreserven mit 6 Mrd. Tonnen rd. 21 Jahre. Bis 2007 erfolgte ein Anstieg auf 46 Jahre (180 Mrd. Tonnen). Heute liegt die geschätzte Reichweite bei ca. 40 Jahren. Prognosen wie “Peak Oil” haben sich bislang nicht erfüllt.
Die Rohstoffpreise schwanken und folgen einem stochastischen Pfad. Wenn aber die Gewinne aus der Rohstoffextraktion den hierbei verlustig gehenden Wert des “Warten-Könnens” nicht mehr überkompensieren können (r<f), wird die Expansion der Rohstoffförderung vorübergehend ausgesetzt. Die Knappheit und die knappheitsbedingten Preissteigerungen (sowie die sog. Ressourcen-Renten) werden dann gegenüber dem nach der Hotelling-Regel zu erwartendem Pfad längerfristig gedämpft.
Was sind die Konsequenzen dieser Ergänzung des Hotelling-Theorems für die Energiewende? Die Verbreitung grüner Technologien hat eine Entwertung des Ressourcenbestandes in situ zur Konsequenz – so dass f fällt, ja sogar negativ werden kann (in der Terminologie des Realoptionsansatzes erhöht sich die “Dividende”). Das Gleichgewicht r + f = v wird hierdurch gestört gestört, weil r>f. Der Ressourceneigentümer kann sein Vermögen dann nur maximieren (Zielfunktion), wenn er das negative f durch ein entsprechend steigendes r ausgleicht. Weil die Nachfrage nach nicht erneuerbaren Ressourcen infolge der grünen Transformation sinkt, geht auch deren Preis zurück. Um den Vermögenswert zu maximieren, muss dann der sinkende Preis durch eine steigende Extraktionsmenge ausgeglichen werden. Auf gut Deutsch: Die Konsequenz aus der sinkenden Nachfrage nach nicht erneuerbaren Ressourcen ist, dass mehr (fossile) Ressourcen aus dem Boden geholt und auf den Markt gebracht werden. Dann aber tritt genau das ein, was Hans-Werner Sinn als grünes Paradoxon bezeichnete. Folgendes ist also zu erwarten:
- Die grüne Transformation führt zu einer sinkenden Nachfrage nach nicht erneuerbaren Ressourcen und bedrohen langfristig deren Werthaltigkeit.
- Entwicklungs- und Schwellenländer fragen verstärkt die im Preis gesunkenen Ressourcen nach.
- Diese Länder treten an die Stelle der verzichtenden grünen Transformationsländer, so dass deren Anstrengungen bzgl. Energiewende konterkariert werden.
- Je weiter f in den negativen Bereich abrutscht, umso mehr unterliegt die Angebotsseite einem Druck in Richtung beschleunigter Ausbeutung der Ressourcen.
Oder, wie Hans-Werner Sinn es sinngemäß ausdrückte: Wenn der Scheich merkt, dass der Wert seiner Ölvorkommen wegen der grünen Transformation sinkt, holt er so viel wie möglich aus dem Boden, solange der Preis noch einigermaßen anständig ist. Im Endeffekt erweist sich die – sehr teure – Vorreiterrolle der westlichen Transformationsökonomien somit als für das Klima desaströs: “Gut gemeint” ist dann wieder einmal das Gegenteil von “gut”.
Was wäre die Lösung? Sinn spricht von einer Stärkung der Eigentumsrechte der Ressourceneigentümer. Dies könnte das fallende f bremsen; aus allokativer Perspektive ist der Gedanke folgerichtig. Dennoch stößt er auf verteilungspolitische und ethische Bedenken (die hier nicht weiter vertieft werden können). Eine weitere Möglichkeit wäre die Kompensation des fallenden f durch Zahlungen der Transformationsländer an die Ressourceneigentümer. Die Scheichs müssten also durch uns kompensiert werden, damit diese auf die beschleunigte Ausbeutung der Ressourcen verzichten – und die Kompensationen müssten im Zeitverlauf steigen. Diesen Weg, den Edenhofer diskutiert, dürfte die Kosten der Energiewende in den Transformationsökonomien schnell bis in einen Bereich jenseits der Tragfähigkeit treiben und zudem kaum auf politische Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen.
Ein weiteres Instrument wäre eine Besteuerung fossiler Energien in den Transformationsländern. Sinn lehnt dies konsequenterweise ab – zu Recht, da diese den Verfall von f beschleunigen könnten. Eine Quellensteuer bei der Anlage der Gewinne aus der Ressourcenextraktion hält er hingegen für möglich – politisch dürfte dies allerdings kaum machbar sein.
Eher gangbar scheint ein “Klima-Club” zu sein, in dem die großen Ressourcenverbraucher (und vielleicht auch Erzeuger) vereint wären: Die USA, die EU, China und vielleicht auch Russland (weil Rohstoff-Supermacht). In diesem Klima-Club würde nach gemeinsamen Regeln gespielt. Diese sind ein gemeinsamer CO2-Cap und ein Emissionshandel, idealerweise auch mit einem “Klimageld” bei der Versteigerung der CO2-Zertifikate. Es gibt ein Cross-Border-Adjustment: Wer in das Club-Gebiet mit seinen Waren will, muss sich den dort geltenden Regeln anschließen oder zahlen. Umgekehrt werden die Club-Mitglieder bei Exporten außerhalb des Club-Gebietes entlastet. Der Club hätte Erfolg, wenn immer neue Mitglieder hinzutreten, die sich seinen Regeln dauerhaft unterwerfen. Allerdings setzt auch ein solcher Klima-Club mit dem CO2-Handel zunächst an der Nachfrageseite an. Dennoch könnte man seine Wirkungskraft auch auf die Angebotsseite ausdehnen. Beispielsweise könnte könnte man – vorübergehend – auf ein Klimageld verzichten und die Ressourceneigentümer statt dessen bei einer zukunftsfähigen Transformation ihrer Ökonomien unterstützen. Das Ziel wäre, diese von den Ressourcenrenten unabhängig zu machen – nicht aber, die versiegenden Ressourcenrenten zu stützen. Einige arabische Staaten machen schon heute ohne externe Unterstützung bemerkenswerte Fortschritte in diese Richtung.
Um einen Klima-Club zu installieren, bedarf es erheblicher diplomatischer Anstrengungen. Hier könnte Deutschland potenziell eine Rolle spielen – allerdings nicht mit einer Außenministerin, die zentrale potenzielle Clubmitglieder mit dem Etikett “Diktatur” belegt. Möglicherweise eröffnen gegenwärtige Probleme jedoch für die Zukunft auch Chancen: Beispielsweise könnte man Russland die Aussicht eröffnen, im Gegenzug für seine Kooperation in die Staatengemeinschaft zurückzukehren und den Status als Paria hinter sich zu lassen. So gering die Chancen für einen Klima-Club sind: Er hat eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als Welt-Klimakonferenzen mit fast 200 teilnehmenden Staaten.
Deutschland könnte jedoch an anderer Stelle als Vorreiter aktiv werden: So bei neuen Technologien, die bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen. Hierzu benötigte es jedoch der Technologieneutralität, auch bei der Forschungsförderung. Der Weg hierbei ist aber Ordnungspolitik, nicht Industriepolitik. Die gegenwärtige Bundesregierung (wie auch die EU-Kommission unter von der Leyen) ist jedoch genau umgekehrt unterwegs: Bestimmte Technologien (Wärmepumpe, Wind, Solar etc.) sind erwünscht, andere (Verbrenner, Kernkraft etc.) verpönt.
Es ist Zeit, die Richtung grundsätzlich zu korrigieren.