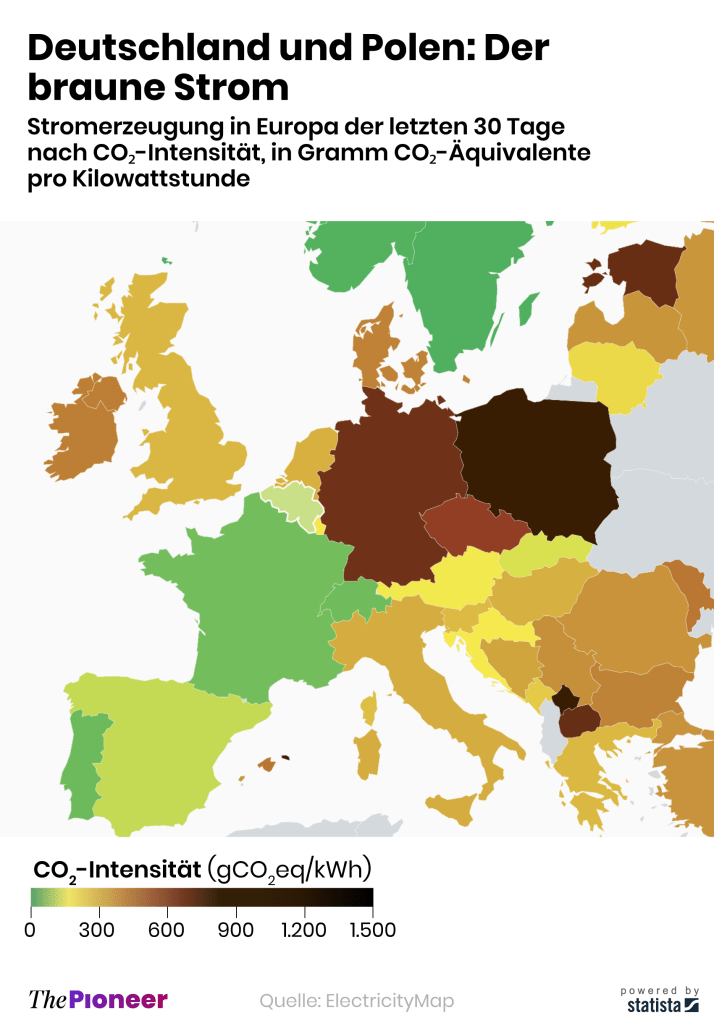Dirk Löhr
Seit 2021 arbeitet die EU an der Neufassung der Gebäudeeffizienzrichtlinie (im EU-Jargon “EPBD”). Die jüngste Entwicklung: Am 12. März 2024 hat das Europäische Parlament die Neufassung beschlossen.
Der Ausstieg aus mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln bis 2040 ist nunmehr lediglich ein „indikatives Ziel“. Die Mitgliedsstaaten haben damit zur Erreichung des Gesamtziels eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 entsprechende Spielräume.
Anders als in früheren Fassungen sind nun auch keine individuellen Sanierungspflichten für Wohngebäude mehr vorgesehen. Vielmehr werden allgemeine Vorgaben zur Reduktion des Energieverbrauchs über den gesamten Wohngebäudebestand gemacht. Wie diese konkret umgesetzt werden, wird darüber entscheiden, ob und inwieweit die Befürchtungen von Haus und Grund, nach der viele Eigentümer überlastet würden, gerechtfertigt sind. Offensichtlicher belastet sind die Eigentümer der energetisch schlechtesten Nichtwohngebäude, für die es auch in der nunmehr verabschiedeten Fassung der Richtlinie Sanierungspflichten geben soll.
Das ursprünglich drohende Szenario, das tatsächlich auf eine kalte Enteignung der Hauseigentümer hinausgelaufen wäre, wurde in diesem Blog im Herbst 2023 beschrieben. Die Weiterentwicklung der Richtlinie ist insofern positiv, dass die betreffenden Vorgaben gegenüber früheren Fassungen abgeschwächt wurden. Dennoch stellt sich nach wie vor die Frage nach der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit der Richtlinie: Reicht die Einbeziehung der Gebäude in den EU-Emissionshandel nicht für die Erreichung der Ziele aus, wenn man ihn entsprechend konsequent durchführt? Die Gebäudeeigentümer könnten dann selbstständig darüber entscheiden, welche Investitionen noch sinnvoll und vertretbar sind.
Wichtig wäre allerdings, die Ausweitung des Emissionshandels mit einem Klimageld zu verkoppeln, über das die Einnahmen aus der Vergabe der CO2-Zertifikate wieder an die Bürger zurück verteilt werden: Bei Wohngebäuden werden die Mieten ansteigen, sofern die Eigentümer die Modernisierungskosten wirtschaftlich umlegen können. Hierbei kommt es weniger auf die rechtlichen Vorschriften, sondern v.a. auf die Marktlage an: Soweit nicht die Nebenkosten (Heizkosten) in gleichem Umfang sinken, reduziert jeder Euro, der den Mietern für die Deckung von Modernisierungskosten abverlangt wird, die verbleibenden Reinerträge und damit auch den Wert der Immobilien. Die Mieter haben ja infolge der Verschärfung des CO2-Handels nicht mehr Geld in der Tasche und müssen daher in die Lage versetzt werden, die Beteiligung an den Modernisierungskosten auch aufzubringen. Die Gefahr des Wertverfalls betrifft im Übrigen auch selbst genutzte Immobilien (das wird deutlich, wenn man sich eine fiktive Vermietung an sich selbst vorstellt).
Angesichts der geplanten Ausweitung des Emissionshandelsregimes ist unverständlich, warum für Nichtwohngebäude nach wie vor eine Sanierungspflicht gelten soll. Was ist beispielsweise mit Lager- und Betriebshallen, die auch im Winter kaum oder gar nicht geheizt werden? Wenn man den vielfältigen möglichen Konstellationen gerecht werden wollte, entstünde ein bürokratisches Monster. Das CO2-Handelssystem regelt solche Konstellationen unbürokratisch von alleine: Heizt eine Firma bestimmte Hallen nicht, wird es auch keine energetische Sanierung vornehmen. Wird teilweise geheizt, beurteilt der Eigentümer vor dem Hintergrund der konkreten Situation, ob eine (teilweise) energetische Sanierung oder die Zahlung der (durch die CO2-Abgaben) erhöhten Energiekosten sinnvoller ist. Auch unnötige Sanierungen sind eine unökologische Verschwendung von Ressourcen. Zudem werden die Belastungen durch verpflichtende Sanierungen v.a. die Eigentümer von Nichtwohngebäuden in wirtschaftlich schwachen, peripheren Regionen besonders hart treffen.
Der Befund: Die Gebäudeeffizienzrichtlinie ist in weiten Teilen (v.a. mit Blick auf die verbleibenden Sanierungspflichten) überflüssig und bezüglich der Ausweitung des Emissionshandels auf den Verkehrs- und Gebäudesektor redundant – es reicht die konsequente Durchführung des Emissionshandels (bei Begleitung durch ein Klimageld) vollkommen aus. Die Richtlinie ist somit in weiten Teilen wieder einmal ein gutes Beispiel für eine sich verselbstständigende wie überflüssige Bürokratie, die in Sonntagsreden noch verdammt und am Dienstag darauf (der 12. März war ein solcher) dann doch vorangetrieben wird.